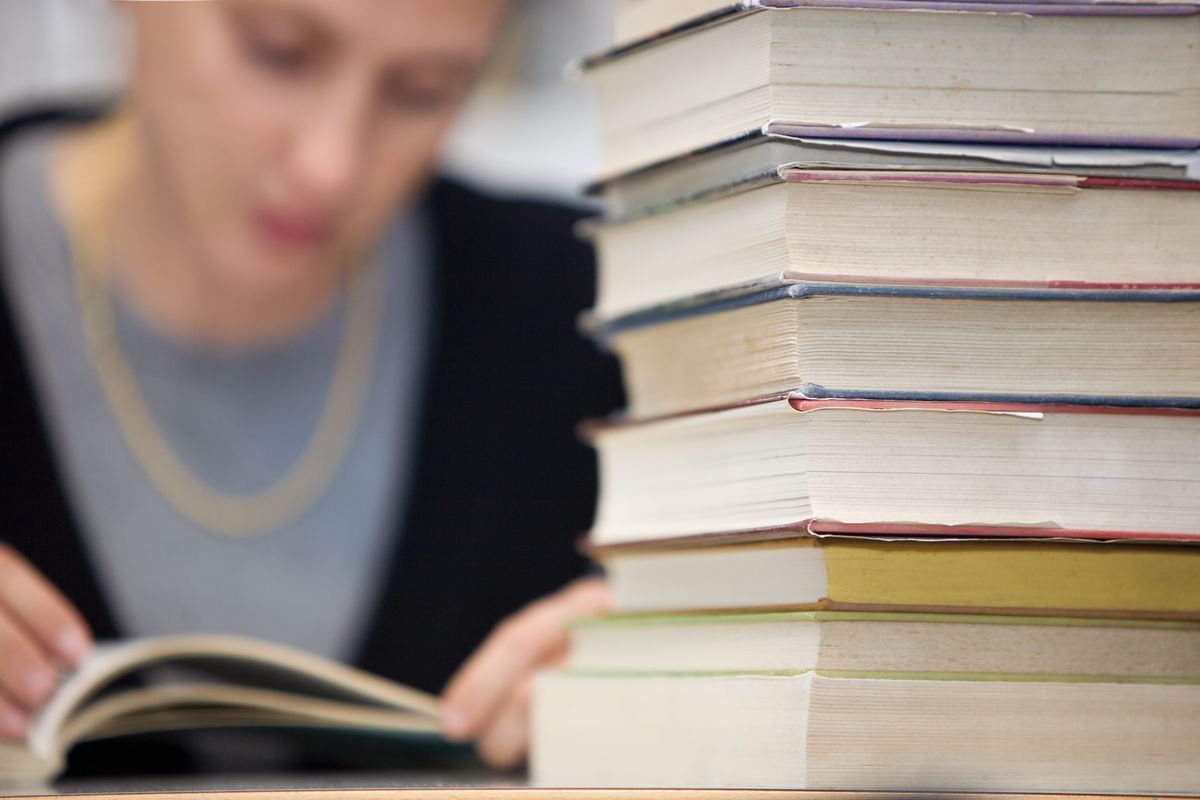Sie interessieren sich für eine Abschlussarbeit in unserer Arbeitsgruppe? Auf dieser Seite finden Sie Informationen zu möglichen Themen für Abschlussarbeiten, aktuellen Ausschreibungen, dem Ablauf zur Themenvergabe, sowie Informationen zu unserem Betreuungskonzept. Wie freuen uns, von Ihnen zu hören!
Welche Möglichkeiten für Abschlussarbeiten gibt es?
Wir bieten eine Reihe spannender Bachelor- und Masterarbeiten zu verschiedenen entwicklungspsychologischen Forschungsthemen unserer Arbeitsgruppe an. Anbei finden Sie Themenbereiche, in denen Abschlussarbeiten geschrieben werden können (Stand: 11. Oktober 2024). Wir sind jedoch auch offen für eigene Themenvorschläge und Initiativmeldungen! Beachten Sie in jedem Fall die allgemeinen Hinweise zur Themenvergabe.
Bitte beachten Sie, dass wir momentan nur Qualifikationsarbeiten zu ausgeschriebenen Themen vergeben (siehe unten!).
Generell betreuen wir Bachelor -und Masterarbeiten in folgenden Themenbereichen:
- Erfolgreiche Entwicklung vom Jugendalter bis ins hohe Alter; Entwicklungsbereiche: Emotionsregulation, emotionale Reaktivität, Weisheit, Achtsamkeit (Prof. Dr. Ute Kunzmann)
- Empathie über die Lebensspanne, Konfliktmanagement in Berufs- und Bildungskontexten, Achtsamkeit (Dr. Cornelia Wieck)
- Sozialkognitive und prosoziale Entwicklung in Kindheit und Jugend; Entwicklung von epistemischen Verständnis (Dr. Marie Schäfer)
- Emotionale Kompetenzen (z.B. Emotionsregulation und Emotionsdifferenzierung) im Jugendalter und Entwicklung dieser (Felix Sternke, M.Sc.)
Wenn Sie Interesse an einer Bachelor- oder Masterarbeit in unserer Arbeitsgruppe haben, haben Sie mehrere Möglichkeiten:
- Sie bewerben sich auf eine Abschlussarbeit. In diesem Fall senden Sie bitte eine E-Mail mit einer kurzen Motivation, warum Sie sich für das Thema interessieren, an die Kontaktperson in der Ausschreibung.
- Sie bewerben sich mit einem eigenen Themenvorschlag. In diesem Fall kontaktieren Sie initial eine:n mögliche:n Betreuer:in via E-Mail. Diese E-Mail sollte eine kurze Beschreibung Ihres Vorhabens enthalten. Bei eigenen Themenvorschlägen werden wir abklären, ob wir das Vorhaben adäquat betreuen können und ob das Vorhaben im Rahmen einer Abschlussarbeit realisierbar ist.
- Wenn momentan keine Arbeiten ausgeschrieben sind oder Sie andere Themen interessieren, können Sie unverbindlich bei eine:m mögliche:n Betreuer:in vie E-Mail nach offenen Themen für Abschlussarbeiten anfragen. Gehen Sie bitte kurz darauf ein, warum Sie sich melden und für welche Themen Sie sich interessieren.
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht und melden uns zeitnah bei Ihnen zurück!
Wie läuft eine Abschlussarbeit in der Arbeitsgruppe ab?
Die Bearbeitung von Bachelorarbeiten ist für das Sommersemester vorgesehen. In Einzelfällen können wir auch Abschlussarbeiten im Wintersemester betreuen. Beachten Sie jedoch, dass Sie in jedem Fall am Kolloquium für die Bachelorarbeit in unserer Arbeitsgruppe teilnehmen müssen, welches immer im Sommersemester stattfindet.
Der Bearbeitungszeitraum für Bachelorarbeiten beträgt 23 Wochen.
Die Bearbeitung von Masterarbeiten ist sowohl im Sommer- als auch im Wintersemester möglich und erstreckt sich häufig über zwei Semester.
Der Bearbeitungszeitraum für Masterarbeiten beträgt 46 Wochen.
Falls Sie Interesse an einer Bachelor- oder Masterarbeit in unserer Arbeitsgruppe haben oder bereits eine schreiben, finden Sie im in diesem Dokument wichtige Hinweise und Informationen zu unserem Betreuungskonzept sowie Gestaltungsrichtlinien für das Exposé und die Abschlussarbeit.
Dieser Übersicht können Sie entnehmen, welche Gutachter:innen-Konstellationen zulässig sind - und welche nicht.